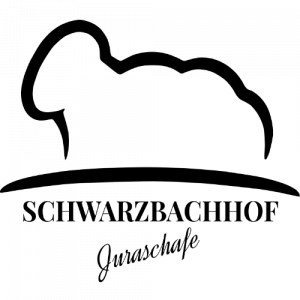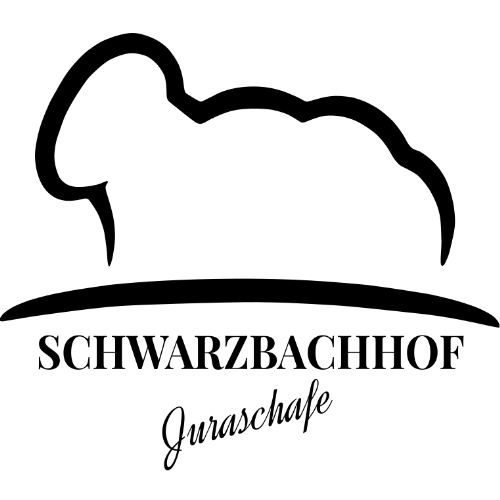Ursprung und Zucht des Juraschafs
Das Juraschaf stammt aus der Schweiz, dort wird es als Schwarzbraunes Bergschaf bezeichnet. Es wurde aus den einheimischen Landschlägen des Jura-, Saanen-, Simmentaler-, Frutigschafes und Roux de Bagnes gezüchtet.
Geschichte und Kultur des Juraschafs
Das Schwarzbraune Bergschaf (Synonym Juraschaf, Elbschaf) ist eine der sechs anerkannten Schafrassen der Schweiz. 1941 wurden die verschiedenen Schläge zum Begriff „Schwarzbraunes Bergschaf“ vereinheitlicht und sind seit 1979 in der Schweiz als eine eigenständige Herdbuchrasse anerkannt. Die erste Herde Juraschafe mit etwa 100 Schafen wanderte 1977 mit den Hirten der Kooperative Longo Maï von der französischen Schweiz über die Alpen nach Kärnten in Östereich und verbreitet sich dank seiner guten Eigenschaften rasch in die angrenzenden Bundesländer. Seit 2020 Ist es auch auf unserem Schwarzbachhof hier in Sachsen angekommen und bildet eine Herde von 28 Tieren aus.


Merkmale des Juraschafs
Das Juraschaf ist ein asaisonales, frühreifes und fruchtbares Schaf mit einem hohen Anteil an Mehrlingsgeburten und einem ausgeprägten Mutterinstinkt. Die Farbe ist einheitlich schwarz, braun oder elbfarben. Der Kopf ist unbewollt, hornlos, mit einem breiten Maul und einer geraden Nasenlinie. Die Ohren sind mittellang und werden aufrecht getragen. Kopf und Beine sind schwarz oder braun behaart.
Das Juraschaf der Alleskönner
Das Juraschaf zeichnet sich durch seine robuste, kräftige Konstitution aus und ist widerstandsfähig sowie standorttreu. Es begeistert durch seine unkomplizierte Haltungsweise. Der Körper des Juraschafs ist harmonisch und tief mit einem guten Wuchs. Rücken, Lende und Keule sind gut bemuskelt, wodurch es sich ideal für die Lammfleischerzeugung eignet. Die Gliedmaßen sind trocken, fein, korrekt und die Klauen sind dunkel.


Lebensraum und Haltung des Juraschafs
Durch seine Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Klimaeinflüsse bei mäßigen Ansprüchen an Futter und Haltungsbedingungen eignet es sich perfekt zur Landschaftspflege von kleinen bis mittelgroßen Flächen, die für große Technik nicht erreichbar sind. Durch seine robuste, kräftige Konstitution kommt es perfekt mit Hanglagen zurecht, auch wenn sie etwas steiler werden. Das Juraschaf ist sehr Standorttreu und eignet sich besonders zur Nutzung von Hochalpen, Erzgebirgswiesen und ähnlichen Flächen die sauber abgefressen werden sollen.
Ernährungsbedürfnisse des Juraschafs
Das Juraschaf ist äußerst anspruchslos und gedeiht gut auf kargen Flächen. Diese Eigenschaft macht es zu einer idealen Wahl für weniger fruchtbare Weidegebiete. Im Winter besteht die Ernährung des Juraschafs hauptsächlich aus Heu, Silage und Heulage, was seinen genügsamen Charakter weiter unterstreicht.


Größe des Juraschafs
Das Juraschaf variiert in Größe und Gewicht je nach Geschlecht. Weibliche Tiere wiegen typischerweise zwischen 65 und 85 kg und erreichen eine Widerristhöhe von 65 bis 75 cm, während männliche Tiere ein Gewicht von 80 bis 130 kg aufweisen und eine Widerristhöhe von 70 bis 80 cm erreichen können.
Zucht und Fortpflanzung des Juraschafs
Das Juraschaf ist sehr fruchtbar, hat ein Erstlammalter zwischen 15-18 Monaten und neigt zu Mehrlingsgeburten von 2-3 Lämmern. Die Geburt findet auf Grund seiner Natürlichkeit meist ohne Betreuung statt. Die frischen Lämmer sind nach sehr kurzer Zeit fit und finden selbstständig zur Milch.


Wolle des Juraschafs
Das Wollvlies des Juraschafs ist von ausgezeichneter Qualität und besitzt nahezu Merinocharakter, es ist dicht, geschlossen und gut gestapelt. Die Feinheit der Wolle liegt im Bereich von 28 bis 31 Mikrometer, und das Gewicht des Vlieses beträgt etwa 3,5 bis 4,0 kg.
Fleischerzeugnisse des Juraschafs
Durch das Gewicht eines Widders von 80 – 100 kg nach 2 Jahren, eignet sich das Juraschaf gut zur Fleischerzeugung. Rücken, Lende und Keule sind gut bemuskelt. Durch seine kräftige Konstitution und genügsame Lebensweise, ist es gut geeignet zur Lammfleischerzeugung.


Milch des Juraschafs
In Fällen von Eiweißunverträglichkeit, beispielsweise bei Kuhmilchallergikern, erweist sich Schafmilch oft als hervorragende Alternative und manchmal sogar als die einzige. Bedauerlicherweise eignet sich das Juraschaf aufgrund seiner hohen Lämmerproduktion nur bedingt als Milchlieferant für ihre Halter und Züchter.